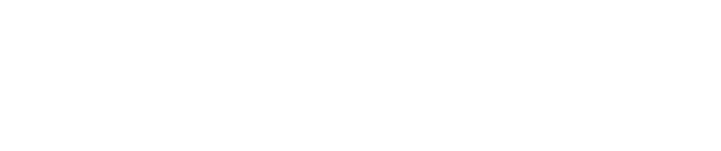Die Briefkunst
Nach dem täglichen Gang zum Briefkasten hält man eher selten Briefe in Händen, bei denen es sich nicht um Rechnungen, Werbung oder dergleichen handelt. Bevor jedoch andere Kommunikationsformen gängig wurden, waren Briefe die Regel. Und wie in allen Kommunikationsformen gibt es bestimmte Gepflogenheiten, einen „guten Ton“. Dieser veränderte und verändert sich immer wieder. In dem 1779 veröffentlichten Werk „Briefe nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“ von C. F. Gellerts geht es, wie der Titel bereits verrät, um die Briefkunst.
Wie hat ein Brief förmlich auszusehen? Welcher Ton sollte bei wem angeschnitten werden?
Der Text sei vor allem für junge Menschen und Frauen verfasst. Gellerts erklärt, ein Brief dürfe weder zu viel noch zu wenig und weder drüber noch drunter sein. Man solle nicht zu geistreich schreiben, aber auch nicht geistlos und man müsse sich bemühen, ohne dass dies sichtbar sei. Diese Beschreibungen an sich sind wenig hilfreich – wie viel ist zu viel?
Damit hier Klarheit herrscht, gibt es Beispiele. Unter anderem werden Briefe verglichen und ein weiterer Vergleich bezieht sich auf Räume. Ein Brief dürfe nicht wie ein leeres Zimmer nur mit dem nötigsten ausgestattet sein. Gleichzeitig dürfe es kein Prunkzimmer mit genug kostbaren Gegenständen für einen Palast sein. Leere sei langweilig, doch der Prunk zerstreue Aufmerksamkeit und ermüde. Ein gut ausgestattetes Zimmer mit weniger und dafür gut platzierter Akzente sei angenehmer und dies übertrage sich ebenfalls auf Briefe.
Hierzu sei zum Beispiel Witz eine Option. Dieser würde Briefe auflockern, mache sie natürlicher und leichter zu lesen. Doch dürfe man nicht auf Biegen und Brechen versuchen, sich gewitzte Formulierungen einfallen zu lassen. Dies wäre wider der Natürlichkeit und missfiele dem Leser. Dementsprechend wären spontane Einfälle natürlich und ansprechend. Im Folgenden wird zur Veranschaulichung mit Gesichtern verglichen. Gellerts schreibt, manche Gesichter seien nicht sonderlich schön und doch gefielen sie durch angenehme Gesichtsausdrücke. Sie würden vielleicht keine Bewunderung erwecken und blieben doch durch angenehme Eigenschaften wie Unschuld, Verschmitztheit oder Leichtigkeit in Erinnerung. Dies sei ebenso auf Briefe zu übertragen.
Zu beachten sei trotzdem, dass Mühe eine wichtige Rolle spiele, da die ersten Gedanken nicht immer die besten seien. Diese Mühe dürfe aber nach wie vor nicht erkennbar sein.
Im Folgenden geht Gellerts weiter auf die Natürlichkeit ein, welche in seinen Augen eine tragende Rolle spielt. Natürlichkeit bringe eine gewisse Leichtigkeit mit sich, welche aus klaren Gedanken und deutlichem Ausdruck entstünde. Wie richtige Rechtschreibung und Grammatik sei aber auch Leichtigkeit nur eine Basis. Die richtige Wortwahl entscheide. Hier orientiere man sich an dem Motto „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Wenige Worte sollen bildmalerisch die Gedanken beschreiben, sodass der Leser weder Langeweile verspüre noch von überflüssigen Worten in schwülstigem Stil überschwemmt werde.
Die Form betreffend sei nur ein Stil richtig: der Natürliche. Man schreibe Gedanken so auf, wie sie einem in den Sinn kämen. Unordnung entstehe hier nur bei unordentlichen, „falschen“ Gedanken und dabei könne Gellerts auch nicht helfen. Doch wer durch Umfeld und Lesen eine vernünftige Art lernte, müsse sich nicht sorgen. In der Schule gelernte Formeln seien also zu vergessen. Briefe solle man insgesamt eher wie Gespräche betrachten, persönlich und frei. Allerdings gebe es nicht ganz dieselbe Freiheit eines Gesprächs, da es sich schließlich um Briefe handele.
Auf den folgenden Seiten werden weitere Briefe beurteilt und Gellerts hebt hervor, was er als guten Stil erachtet und vor allem, was nicht. Darauf folgen 73 Briefe.
Heute ist die schriftliche Kommunikation, zum Beispiel über Apps auf dem Smartphone, oft deutlich simpler. Viele Abkürzungen werden verwendet und ganze Sätze durch Emojis vermittelt. Diese Veränderung hängt auch mit Veränderungen der Gesellschaft und dem Umgang miteinander zusammen.
Auch das Schreiben selbst hat sich verändert. Beispielsweise sind Papier, Stifte und Haltung nicht ganz die Gleichen wie vor 100 oder 200 Jahren, doch dazu mehr in einem anderen Beitrag.